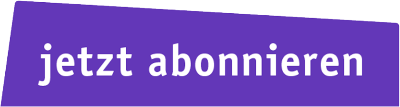Die Vereinten Nationen schlagen Alarm: In seinem Ende Juli vorgestellten Bericht zur Umsetzung des Rechts auf Nahrung kritisiert der UN-Sonderberichterstatter Dr. Michael Fakhri die zunehmende Machtkonzentration im globalen Ernährungssystem. Fakhri kommt zu dem Ergebnis, dass wenige transnationale Konzerne bestimmen, was wir essen, wie Lebensmittel produziert werden und zu welchem Preis sie erhältlich sind. Die Folgen für Umwelt, Gesundheit und Menschenrechte sind gravierend. An mehreren Stellen stützt sich der Bericht auf Eingaben von FIAN und unseren Partnerorganisationen.
Die Lebensmittelproduktion hat sich seit den 1960er Jahren rasant industrialisiert. Mit jeder Welle an Fusionen und Übernahmen wurde die Marktmacht stärker konzentriert. Heute kontrollieren vier Konzerne (Bayer, Corteva, Syngenta, BASF) über die Hälfte des kommerziellen Saatgutmarktes und mehr als 60 Prozent des Pestizidmarktes. Ähnlich dominant ist eine kleine Zahl von Anbietern bei Düngemitteln, Landmaschinen und Tierarzneien. Diese Oligopole treiben Preise nach oben, drücken Löhne nach unten und schaffen Abhängigkeiten, welche Kleinbäuer*innen und Konsument*innen gleichermaßen entrechten.

Koloniale Wurzeln bestehender Machtstrukturen
Das heutige Ernährungssystem ist aus kolonialen Strukturen hervorgegangen. Schon im 19. und frühen 20. Jahrhundert legten imperiale Märkte fest, welche Regionen Rohstoffe liefern sollten und welche Produktionsweisen zugelassen waren. Ganze Gebiete wurden auf Exportpflanzen wie Zuckerrohr, Baumwolle, Kakao oder Kaffee festgelegt, während die lokale Nahrungsmittelproduktion verdrängt wurde. Der Sonderberichterstatter sieht hierin die Wurzeln der heutigen Situation: „Das Problem der Macht weniger Unternehmen im Lebensmittelsektor reicht Jahrhunderte zurück. Das Besondere heute ist die Ausweitung der Macht der Unternehmen auf alle Aspekte des Lebensmittelsektors“ (A/80/213, para. 3).
Ungleichheit und Landkonzentration
Extreme Landungleichheit bleibt eine Hauptursache für Hunger und Mangelernährung. Wer Land besitzt, entscheidet darüber, wer Nahrung produzieren und davon leben kann. Sonderberichterstatter Fakhri zitiert hierzu die Zahlen der FIAN-Studie Lords of the Land, in der FIAN die globalen Muster der Landkonzentration detailliert dokumentiert hat: „In den letzten Jahrzehnten haben große transnationale Konzerne mit aktiver Unterstützung der Regierungen in großem Umfang Land von Kommunen und lokalen Gemeinschaften gekauft. So kommt es, dass gerade mal 1 Prozent der industriellen Landwirtschaftsbetriebe inzwischen 70 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche kontrollieren […]. Dieser Land- und Wasserraub, der im Namen der Steigerung von Produktivität durchgeführt wird, hat indigenen Völkern und ländlichen Gemeinschaften geschadet, indem er ihre Lebensweise gestört, ihren Zugang zu guten Nahrungsmitteln und Wasser eingeschränkt und lebenswichtige Ressourcen entzogen hat“ (A/80/213, para. 33).
Agrarland ist dabei immer stärker zu einem Finanz- und Spekulationsobjekt geworden – mit gravierenden wirtschaftlichen Folgen: Millionen Menschen werden von ihrem Land vertrieben oder in unsichere Arbeitsverhältnisse gedrängt. Indigene Völker verlieren nicht nur ihre Lebensgrundlage, sondern auch ihre kulturelle Identität und ihre Verbindung zu Territorien. Dieser Trend wird durch technische Neuerungen vorangetrieben, wie durch die Digitalisierung von Landtiteln in Brasilien und Indien, durch welche indigene Völker über Nacht faktisch enteignet wurden. Diese Entwicklungen machen deutlich, dass ohne eine grundlegende Umverteilung von Landbesitz die Verwirklichung des Menschenrechts auf Nahrung nicht erreicht werden kann.
Folgen für Umwelt, Gesundheit und Menschenrechte
Die Konzentration von Macht im Ernährungssystem hat weitreichende Folgen, die über rein wirtschaftliche Fragen hinausgehen. Der Sonderberichterstatter beschreibt eindrücklich, wie die industrielle Landwirtschaft die natürlichen Lebensgrundlagen vieler Menschen zerstört. Monokulturen, die sich auf chemische Düngemittel und Pestizide stützen, führen zu Bodenerosion, zur Verschmutzung von Flüssen und zum Verlust der Artenvielfalt. Diese Produktionsweisen sind zudem ein zentraler Treiber der Klimakrise. Sie stoßen große Mengen an Treibhausgasen aus und verstärken durch die Abholzung von Wäldern die globale Erwärmung. Die Folgen sind bereits heute spürbar. Ernteausfälle durch Dürren und Überschwemmungen nehmen zu.
Parallel dazu breitet sich der Konsum hochverarbeiteter Produkte aus. Vor diesem Trend warnt der Sonderberichterstatter mit deutlichen Worten: „Hochverarbeitete Produkte basieren auf billigen, leicht austauschbaren Zutaten, sind lange haltbar, machen süchtig, führen zu Überkonsum, bergen ein hohes Risiko für Fettleibigkeit und nicht übertragbare Krankheiten und können zu einem viel höheren Preis als ihren Produktionskosten verkauft werden. Das Ergebnis ist, dass Unternehmen die Ernährungsvielfalt verringern“ (A/80/213, para. 18). Insbesondere Kinder sind die Zielgruppe des aggressiven Marketings für diese Produkte. Das Wachstum von Supermärkten und Fast-Food-Ketten vielerorts begünstigt die Entwicklung und verdrängt kleinere Märkte mit lokal erzeugten Lebensmitteln.
Politik oftmals an Konzerninteressen orientiert
Die Konzentration der Lebensmittelproduktion schwächt auch die Demokratie. Große Unternehmen können enormen Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen. Sie wirken auf Gesetzgebungsprozesse, Handelsabkommen und internationale Institutionen ein. Viele Regierungen passen ihre Agrar- und Handelspolitik an Konzerninteressen an, weil sie auf Investitionen hoffen oder durch internationale Verträge oder den Schuldendienst gebunden sind. Die Stimmen der Kleinbäuer*innen, Landarbeiter*innen, indigenen Gemeinschaften und Konsument*innen, die allesamt am stärksten betroffen sind, bleiben dagegen weitgehend ungehört. Diese Entwicklung ist auch bei den Vereinten Nationen sichtbar. Ausdrücklich kritisiert der Sonderberichterstatter den unverhältnismäßig hohen Einfluss von Konzernen beim UN-Weltgipfel zu Ernährungssystemen.
Damit werden grundlegende Menschenrechte verletzt. Das Recht auf Nahrung wird systematisch untergraben, wenn Ernährungssysteme auf Profitmaximierung statt auf Versorgungssicherheit ausgerichtet sind. Auch Arbeitsrechte sieht der Sonderberichterstatter bedroht: „Die Arbeitnehmer*innen erhalten oft keinen existenzsichernden Lohn, werden zu langen Arbeitszeiten gezwungen, haben keine Verträge und keinen Sozial- oder Mutterschutz, sind Diskriminierung ausgesetzt, sind ohne angemessenen Schutz schädlichen Substanzen ausgesetzt und ihr Recht auf gewerkschaftliche Organisation wird eingeschränkt. Frauen und Wanderarbeiter*innen sind mit besonderen Härten konfrontiert, was die bestehenden Ungleichheiten noch verschärft“ (A/80/213, para. 11).
Alternativen und Forderungen
Trotz dieser düsteren Bestandsaufnahme verbleibt der Bericht nicht bei seiner Kritik. Der Sonderberichterstatter verweist auf Alternativen, die in verschiedenen Teilen der Welt entwickelt und praktiziert werden. So setzen Bewegungen für Ernährungssouveränität dem Konzernmodell ein anderes Verständnis entgegen: Gemeinschaften sollen selbst bestimmen können, wie und unter welchen Bedingungen sie Nahrung produzieren, verteilen und konsumieren. Damit geht es nicht nur um Produktionsweisen, sondern auch um Fragen von Macht, Verteilung und demokratischer Kontrolle.
Ein zentraler Ansatz hierbei ist die Agrarökologie. Sie verbindet ökologische Nachhaltigkeit mit sozialer Gerechtigkeit. Agrarökologische Betriebe arbeiten mit vielfältigen Anbausystemen, erhalten die Biodiversität und sind weniger abhängig von externen Schocks. Sie stärken lokale Märkte, reduzieren Transportwege und schaffen sichere Einkommensmöglichkeiten für Bäuer*innen.
FIAN hatte in seinen Eingaben die vielfältigen agrarökologischen Ansätze in Deutschland aufgezeigt und auf die großen Erfolge in Brasilien hingewiesen. Dort hat der Nationale Ernährungsrat unter aktiver Beteiligung von sozialen Bewegungen agrarökologische Programme auf den Weg gebracht, welche Millionen Menschen Zugang zu gesunden Lebensmitteln sichern. Besonders das Schulernährungsprogramm, das lokale bäuerliche Produktion mit öffentlicher Versorgung verbindet, gilt international als Vorzeigemodell. Der Bericht greift die Beispiele auf und macht deutlich, dass solche Systeme widerstandsfähiger gegenüber Krisen sind und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Empfehlungen an Politik
Alternativen zu stärken und die Macht der dominanten Unternehmen einzuschränken erfordert laut UN-Sonderberichterstatter Fakhri konkrete politische Schritte. „Aus menschenrechtlicher Sicht untergräbt die Machtkonzentration von Unternehmen im Ernährungssystem die Handlungsfähigkeit und Autonomie der Menschen“ (A/80/213, para. 76). Deswegen müssen die seit über zehn Jahren andauernden Verhandlungen über ein verbindliches Abkommen zu transnationalen Konzernen, an denen sich auch FIAN aktiv beteiligt, zu einem substanziellen Ergebnis kommen. Monopole müssen reguliert und Wettbewerbsrechte konsequent durchgesetzt werden. Kollektive Rechte an Land und Saatgut müssen rechtlich abgesichert werden, damit Gemeinschaften nicht von Konzernen verdrängt werden. Öffentliche Gelder sollten gezielt in agrarökologische Programme fließen und ungesunde Lebensmittel höher besteuern, anstatt industrielle Großprojekte zu subventionieren. Auch lokale Märkte und städtische Ernährungspolitiken können gestärkt werden, damit Verbraucher*innen Zugang zu gesunden und bezahlbaren Lebensmitteln haben.
FIAN und unsere Partnerorganisationen sehen sich durch diese Schlussfolgerungen gestärkt. Sie zeigen, dass ein grundlegender Kurswechsel nötig ist, um das Menschenrecht auf Nahrung weltweit zu sichern. Ohne einschneidende politische Entscheidungen werden Abhängigkeiten, Ungleichheit und ökologische Krisen jedoch weiter zunehmen. Der Bericht macht jedoch deutlich: Ein gerechtes und nachhaltiges Ernährungssystem ist möglich, es wird bereits in vielen Regionen praktiziert. Die Aufgabe besteht darin, diese Ansätze zu verbreiten und politisch abzusichern.
Zum UN Bericht „Corporate power and human rights in food systems” hier.