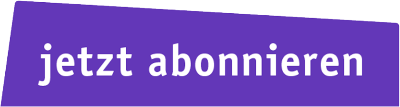Artikel von Sofie-Marie Terrey
Das Recht auf Entwicklung ging aus den postkolonialen Gerechtigkeitskämpfen des 20. Jahrhunderts hervor. Obwohl es bis heute umstritten ist, stärkt es die Rechenschaftspflicht von Staaten – nicht nur bezüglich ihrer internationalen Entwicklungspolitik, sondern auch zur sozialen und wirtschaftlichen Teilhabe ihrer Bürger*innen. Der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Entwicklung wird im November Deutschland besuchen. FIAN beteiligt sich an den Konsultationen.

Das „Recht auf Entwicklung“ wurde erstmalig 1966 in einer Rede des senegalesischen Politikers Doudou Thiam vor der UN-Generalversammlung erwähnt. Thiam kontrastierte dieses Recht mit der kolonial bedingten wirtschaftlichen Ungleichheit der Staaten. Nachdem ein solches Recht durch den senegalesischen Juristen Kéba M’Baye weiter konkretisiert worden war, etablierte es sich im Lauf der 1970er Jahre zunehmend in Foren der Vereinten Nationen. Die Generalversammlung beschloss schließlich 1986 die „Erklärung zum Recht auf Entwicklung“. Laut dieser haben „jeder Mensch und alle Völker das Recht (…), an der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Entwicklung, in der alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll verwirklicht werden können, teilzunehmen, dazu beizutragen und sie zu genießen“.
Postuliert wird also erstens, dass „Entwicklung“ die volle Verwirklichung aller Menschenrechte bezeichnet, insbesondere der im UN-Sozialpakt normierten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte.
Zweitens besteht ein Recht darauf, am Entwicklungsprozess beteiligt zu werden. Im Kontext des Rechts auf Nahrung etwa ergibt sich hieraus das Recht, an der Herstellung eines gesellschaftlichen Zustands teilzuhaben, der eine ausreichende, gesunde und nachhaltige Ernährung für jeden Menschen sicherstellt.
Ein Recht auf globale Gerechtigkeit?
Das Recht auf Entwicklung wird zu den Menschenrechten gezählt. Allerdings muss bei seiner Auslegung der Kontext seiner Entstehung beachtet werden. Nach den Dekolonisierungswellen der 1960er Jahre stieg die Anzahl ehemals kolonisierter Staaten innerhalb der Vereinten Nationen deutlich an. Diese forderten die Beseitigung der durch die Kolonialherrschaft westlicher Staaten verursachten Armut. Ein Recht auf Entwicklung sollte dabei vor allem ihre Handlungsmacht im Prozess ihrer wirtschaftlichen Entwicklung sichern und gegen koloniale Kontinuitäten wirken. Das Recht auf Entwicklung war also Teil einer breiteren Forderung nach globaler Gerechtigkeit. In diesem Sinne war es als Recht gedacht, das nicht nur einzelnen Menschen, sondern auch Völkern zukommt.
Diese zwei Dimensionen stehen nebeneinander, wirken aber unterschiedlich: In der ersten Dimension bietet das Recht auf Entwicklung einen Rahmen, den Staat für sozio-ökonomische Missstände im eigenen Land zur Verantwortung zu ziehen. In der zweiten Dimension verlangt es die Reduzierung wirtschaftlicher Ungleichheiten zwischen Staaten.
Ein umstrittenes Recht
Hieraus ergaben sich aber auch Kontroversen. Insbesondere westliche Jurist*innen lehnten die kollektive Dimension des Rechts auf Entwicklung ab. Viele vertraten eine individualistische Konzeption von Menschenrechten. Nach ihrer Auffassung könnten Rechte nur von Einzelpersonen besessen werden. Diese juristische Kritik korrespondierte mit der politisch begründeten Aversion westlicher Staaten gegenüber diesem neuen Recht. Diese waren oftmals nicht nur Entwicklungshilfegeber, sondern auch ehemalige Kolonisierer. Sie befürchteten insbesondere, dass rechtliche Ansprüche auf Entwicklungshilfe oder auf einen Ausgleich wirtschaftlicher Ungleichheit gegen sie gerichtet werden würden. Ab den 1990er Jahren wurde aber zumindest die grundsätzliche Existenz des Rechts auf Entwicklung zunehmend von westlichen Staaten befürwortet.
Ein bindender Völkerrechtsvertrag in Sicht?
In den letzten Jahren konnten zumindest vage Fortschritte in der Rechtsentwicklung beobachtet werden. Die völkerrechtliche Wirkungskraft des Rechts auf Entwicklung wurde bisher dadurch beeinträchtigt, dass die „Erklärung über das Recht auf Entwicklung“ sowie andere Dokumente, in denen das Recht verankert ist, völkerrechtlich als soft law gelten, also nicht rechtlich bindend sind. Seit 2018 aber hat die UN-Arbeitsgruppe zum Recht auf Entwicklung einen Entwurf für einen bindenden völkerrechtlichen Vertrag erarbeitet. Dieser würde nicht nur alle Unterzeichnerstaaten verpflichten, mehr Rechenschaft über ihre innerstaatliche Umsetzung des Rechts abzulegen. Der Vertragsentwurf enthält auch eine Verpflichtung zur internationalen Kooperation, die unter anderem die Schaffung gerechterer Bedingungen für wirtschaftlich schwächere Länder auf globalen Handels- und Finanzmärkten verlangt.
Der Abschluss des Vertrags wäre ein deutliches Zeichen hin zu gemeinschaftlichem Handeln für nachhaltige Entwicklung und einer Verantwortungsübernahme durch westliche Länder. Die historischen Kontroversen zeichnen sich hier aber weiter fort: Bisher konnte keine ausreichende Unterstützung für ein Vertragsschlussverfahren gefunden werden.
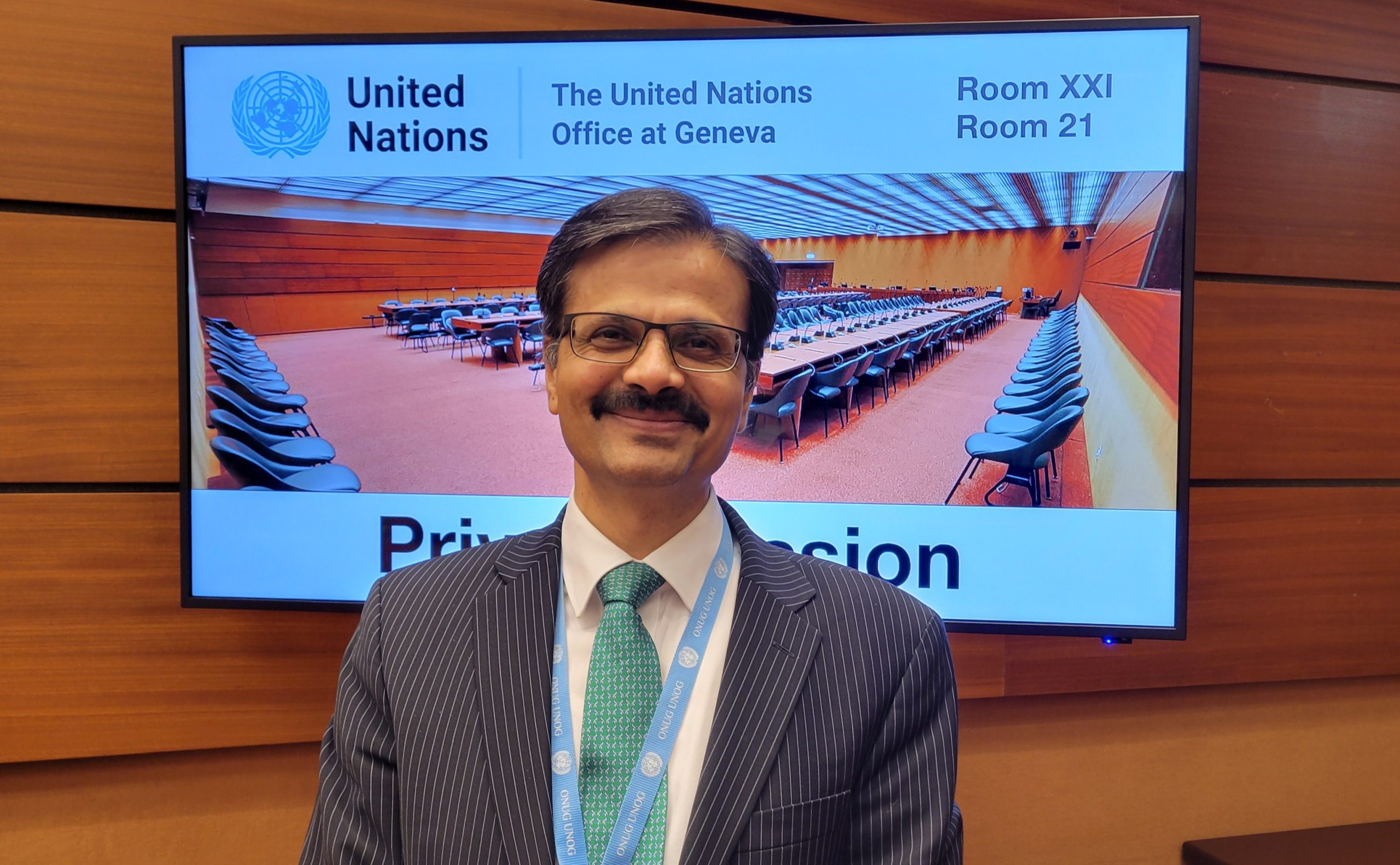
UN-Sonderberichterstatter zum Recht auf Entwicklung
Zugleich hat sich aber auf der Ebene der Vereinten Nationen eine Implementierungsstruktur für das Recht auf Entwicklung gebildet, die wichtige menschenrechtliche Arbeit leistet. 2017 schaffte der UN-Menschenrechtsrat das Mandat für einen Sonderberichterstatter zum Recht auf Entwicklung. Dieser erarbeitet seither nicht nur jährliche Berichte zur Umsetzung des Rechts auf Entwicklung in Bezug auf bestimmte Kontexte, wie etwa der Bekämpfung des Klimawandels oder der Regulierung von Konzernen.
Er überprüft auch die Umsetzung beider Dimensionen des Rechts auf Entwicklung im Rahmen von Länderbesuchen: Zum einen kontrolliert er die sozio-ökonomische Situation innerhalb von Ländern und legt dabei ein besonderes Augenmerk auf die soziale und wirtschaftliche Teilhabe von Gruppen, die von Diskriminierung betroffen sind, wie etwa Frauen, Indigene oder Menschen mit Behinderung. Zum anderen wird die Entwicklungspolitik einer kritischen Betrachtung unterzogen – und zwar nicht nur auf Seiten der Adressatenländer, sondern auch der Geberländer. Etwa notierte der Sonderberichterstatter in Vietnam Fälle von Vertreibung lokaler Gemeinden aufgrund von Entwicklungsprojekten, ohne dass diese adäquat beteiligt oder kompensiert wurden. Nach seinem Besuch in der Schweiz wiederum kritisierte er, dass der schweizerische Markt nicht gut zugänglich für Nahrungsmittelimporte aus wirtschaftlich schwächeren Ländern sei. Dies erschien dem Sonderberichterstatter als konträr zu den entwicklungspolitischen Anstrengungen der Schweiz.
An der Arbeit des Sonderberichterstatters wird deutlich, dass das Recht auf Entwicklung die Gelegenheit bietet, die Rechenschaft von Staaten in Bezug auf eine Vielzahl von sozialen und wirtschaftlichen Problemen zu erhöhen. Während sich das Mandat anderer Sonderberichterstatter*innen auf einzelne Rechte beschränkt, wie etwa das Recht auf Nahrung, kann der Sonderberichterstatter für das Recht auf Entwicklung bereichsübergreifend arbeiten. Man sieht auch, wie die im Recht auf Entwicklung enthaltene Forderung nach Teilhabe am Entwicklungsprozess aller gesellschaftlicher Gruppen das in den Menschenrechtsverträgen enthaltene Diskriminierungsverbot stärkt.
Fazit
Das Recht auf Entwicklung hat dazu beigetragen, Entwicklung und Menschenrechte als intrinsisch miteinander verbunden zu sehen und Forderungen nach Selbstbestimmung und wirtschaftlicher Gerechtigkeit in die Entwicklungspolitik hineinzutragen. Gleichzeitig kann das Recht als Vehikel für vielfältige Forderungen nach sozio-ökonomischer Teilhabe von Bürger*innen gegen ihren Staat dienen.
Die Aussicht auf einen bindenden völkerrechtlichen Vertrag ist derzeit jedoch gering. Auch Deutschland verhielt sich diesbezüglich bisher stets zurückhaltend. Würde ein einflussreiches Land wie Deutschland sich hinter den Vertragsentwurf stellen, hätte dies sicherlich eine beachtliche normstärkende Wirkung.
Sofie-Marie Terrey ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Freien Universität Berlin und promoviert zur menschenrechtlichen Verantwortung europäischer Entwicklungsfinanzinstitutionen. Sie engagiert sich im AK Jura von FIAN.
Neugierig geworden? Das FoodFirst-Magazin können Sie hier abonnieren. Oder sichern sie sich ein kostenloses Probeexemplar in gedruckter Form. Schreiben Sie einfach eine Mail an info@fian.de.