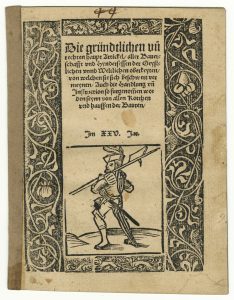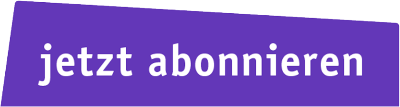Der Deutsche Bauernkrieg stand im Zeichen des Umbruchs von der Logik der Allmende hin zu Markt und Eigentum. Diese Entwicklung bildete sich fort in der Kolonialisierung und bildet die Grundlage heutigen Hungers. Die „Zwölf Artikel von Memmingen“ vom März 1525 waren die zentralen Forderungen der aufständischen Bauern. Sie verlangten das Ende der Leibeigenschaft, gerechte Abgaben und das Recht auf Nutzung von Gemeindeland, Wäldern und Gewässern. Zudem forderten sie eine Begrenzung von Frondiensten sowie das Recht, sich gegen ungerechte Herrschaft zu wehren.
Es sind nun genau 500 Jahre, dass sich ein Großteil der Bevölkerung erhob gegen die steigende Ausbeutung durch jene, die sich als ihre »Herrschaften« verstanden. Vom Schwarzwald ausgehend über den Bodensee hinaus bis zum Harz eroberten die überwiegend bäuerlich Lebenden Klöster und Burgen – nicht zuletzt, um dort lagernde Schuldscheine zu verbrennen, die sich aus steigenden Pachten ergeben hatten. Bis in den Mai 1525 hinein kapitulierten viele Städte kampflos. Nicht selten wurden von diesen anschließend Verordnungen verfasst, die ihre Rechte auf Wald- und Landnutzung sowie auf ihre dörfliche Selbstverwaltung regelten – wie es zuvor jahrhundertelang der Fall gewesen war. Die „12 Artikel von Memmingen“ sind nur die berühmtesten davon.
Die gestiegene Ausbeutung lag nicht einfach an der steigenden Gier des herrschenden Adels. Es war die Zeit, in der sich – beginnend als Handelskapitalismus – die Marktwirtschaft ausformte. Und die damit den Umbruch vom Mittelalter zur Neuzeit darstellt. Der bis zur Französischen Revolution größte Aufstand auf europäischem Boden war die Reaktion darauf.
Denn unterhalb der feudalen Herrschaft war das bäuerliche Leben des Mittelalters von „Commons-Logiken“ durchzogen: Das Land war Allmende. Eigentum im modernen Sinne existierte nicht. Besitz existierte, denn wer etwas bebaute, der hatte auch ein Recht darauf. Über Besitz hinausgehende Aneignung durch Ritter und Raubritter existierte ebenfalls, doch diese wurde begründet durch Religion und im Zweifel abgesichert durch Gewalt. Das angebliche Schutzverhältnis mit dem eigenen Adel stellte im Wesentlichen nur noch den Schutz vor der Eroberung durch eine andere Herrschaft dar – die Zeit der Einfälle durch Ungarn oder Waräger war lange vorbei. Für die Bäuerlichen machte es kaum einen Unterschied, wer sie ausbeutete.
Die Bäuerlichen drückten in ihren Forderungen – und auch in ihrer eigenen Organisierung – die bis dahin vorherrschende Logik der Allmende aus. Das betraf nicht nur – wie heute vielfach angenommen – eine gemeinschaftliche Weidefläche im Dorf. Allmende war Alltag. In Dorfversammlungen wurde über den Anbau gemeinschaftlich entschieden, das Land teilweise auch gemeinsam bestellt, teilweise rotierte der Landbesitz sogar. Trotz zunehmenden Frondiensten und Abgaben konnten die Bäuerlichen sich aus weiten Teilen des Landes frei ernähren.
UFFRUR! Utopie und Widerstand im Bauernkrieg 1524/25
Große Landesausstellung des Landesmuseums Württemberg im Rahmen von „500 Jahre Bauernkrieg“
26.4. – 5.10.2025 im Kloster Schussenried
Eigentum erlaubt die Wegnahme von Besitz
Wogegen sie sich wehrten, lässt sich zugespitzt ausdrücken als: Eigentum. Dieser uns heute so selbstverständliche Begriff hat es in sich. Die heutige deutsche juristische Sprache unterscheidet – anders als zumeist die alltägliche – ‚Besitz‘ und ‚Eigentum‘. Um es zu verbildlichen: Ein Mieter ist Besitzer seiner Wohnung, denn Besitz konstituiert sich über Gebrauch. Die Vermieterin ist dessen Eigentümerin. ‚Eigentum‘ beinhaltet im Gegensatz zu ‚Besitz‘ zwei zusätzliche Rechte: Erstens das Recht, andere von der Nutzung einer Sache auszuschließen, auch wenn man selbst sie nicht braucht. Zweitens das Recht, diese zu zerstören.
Für die Durchsetzung des Eigentumgedankens wurde vom Adel auf das Konzept des dominium zurückgegriffen, das im Kontext des Römischen Reichs entstanden war. Denn die Vorstellung unumschränkter Verfügungsgewalt entstammt der Sklaverei. Dominium taucht auch dort erst gegen Ende der Republik auf: um die Zeit, als Hunderttausende von Gefangenen als Zwangsarbeitende nach Italien kamen. Diese begriffliche Innovation war notwendig geworden, um das faktische Recht des patriarchalen Haushaltsvorstands, des pater familias, die von ihm versklavten Menschen töten zu dürfen, juristisch zu fassen. Denn Besitz durfte bis dato auch in Rom nicht zerstört werden.
Es dauerte jedoch noch rund tausend Jahre, bis diese Vorstellung unumschränkter Verfügungsgewalt Westeuropa voll durchdrang. Für die Herrschenden war es ein verlockendes Konzept. Mit Land als dominium wurde es möglich, Pacht von den Bäuer*innen zu verlangen, ohne dies nach Raub aussehen zu lassen. Zwar gab es auch schon in Mesopotamien, Ägypten und Griechenland Modelle, bei denen Land gegen eine Abgabe oder eine Form von Arbeit zur Verfügung gestellt wurde, doch legte erst der römische Eigentumsbegriff die Grundlage für einen Anstrich von Legitimität.
In England war die Entwicklung am deutlichsten: Bäuerliche, die weniger produktiv waren, zum Beispiel da sie nur wenig Land und für den Eigenbedarf anbauten, gerieten durch die Pacht in eine Schuldenspirale und verloren auf diese Weise ihre Lebensgrundlage. Indem mehr Land unter diese ökonomische Ordnung geriet, hatten zunehmend jene einen Vorteil, die durch die Erhöhung ihrer eigenen Produktivität (und die Ausweitung ihres Absatzmarktes) wettbewerbsfähig produzieren und gut zahlen konnten. Diese bekamen Zugang zu noch mehr Land, während andere die von ihnen bebauten Äcker ganz verloren.

Bauern bei der Heuernte, Glasmalerei, Nürnberg, 1530-40 (© Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Foto: M. Runge)
Eigentum erlaubt das Wegnehmen von Besitz. Gut nachzuvollziehen ist das bei John Locke, der als Theoretiker des Eigentums gilt. In seiner „Zweiten Abhandlung über die Regierung“ von 1690 nimmt er als Ausgangspunkt seiner Überlegungen zu Eigentum und den Menschenrechten die demokratischen Grundwerte aus dem englischen Bürgerkrieg von 1648, insbesondere der als frühdemokratische Bewegung bezeichneten Levellers: die Ablehnung von Gewaltherrschaft und Sklaverei (die damals noch nicht rassistisch organisiert war), Gleichheit sowie das Verständnis, dass die Erde allen Menschen gemeinsam gegeben sei. Zusätzlich greift Locke zurück auf den schon bei Thomas Hobbes angenommenen Naturzustand von Freien und Gleichen – als atomisiert lebende Individuen. Daraus leitet er ab, der Mensch als Gattungswesen sei in dreifacher Hinsicht Eigentümer: 1. seiner eigenen Person, 2. seiner Güter und 3. seiner Freiheit. Dieses Eigentum zu erhalten und zu verteidigen sei das „Naturgesetz“. Zu „Eigentum fähig“ und damit berechtigt war für ihn jedoch nur, wer Überschüsse auf dem Markt anbot.
Diese Logik traf auf Ethnien, die – wie Robin Wall Kimmerer in „Geflochtenes Süßgras“ beschreibt – sich der ‚ehrenhaften Ehre‘ verschrieben hatten: Im Bewusstsein darüber, dass immer etwas sterben muss für unsere Ernährung, nie mehr als für den (gemeinschaftlichen) Bedarf zu nehmen. Locke weigert sich, solche Ethnien überhaupt als Gesellschaften anzuerkennen. Eine solche besteht für ihn nur dort, wo eine politische Autorität das von ihm definierte „Naturgesetz“ durchsetzt – die Logik der bürgerlichen Gesellschaft. Diese besagt, wer seine Produktivität nicht durch auf den Markt gebrachten Überschüsse beweist, verwirkt sein Recht auf das Land – es war genau diese Logik, welche jahrhundertelang die Kolonialisierung rechtfertigte.
Grundlage für heutigen Hunger
Zurück zum Bauernkrieg: Es war keineswegs ausgemacht, dass die Bäuerlichen am Ende militärisch unterlegen sein würden. Nachdem der Adel in hunderten Fällen nicht einmal seine Burgen verteidigen konnte, sah er als einzige Chance, ein Söldnerheer aufzustellen und es mit überlegener Waffentechnik auszustatten. Es war der Fürsten Glück – und der Bauern Pech –, dass es einen sehr, sehr reichen Mann gab – sein geschätztes Vermögen auf heute umgerechnet: 358 Milliarden Euro –, der noch dazu eine eigene Kanonenfabrik betrieb und selbst um seine eigenen Besitztümer zittern musste. Jakob Fugger nannte die Bäuerlichen „faules Gesindel“ und warf ihnen vor, „sie wollen reich sein, ohne sich anzustrengen“. Er wurde zum enthusiastischen Finanzier der Aufstandsbekämpfung durch die Aufstellung eines Söldnerheeres.
Die Folgen der bäuerlichen Niederlage sind immens: Zunächst wurden die Menschen von ihrem Land vertrieben, das eingezäunt nun als Eigentum des Adels galt. Später mussten sie in den Fabriken der Kapitalbesitzenden für ihren Lebensunterhalt schuften. So ist die aus Eigentum abgeleitete Logik, dass Lebensmittel und alles andere dorthin gehen, wo das Geld ist, nicht dorthin, wo Hunger und anderer Mangel herrscht, seit Mitte des 19. Jahrhunderts elementare Grundlage einer globalisierten Marktwirtschaft. Dieser Hunger entsteht nicht zuletzt, weil bis heute – und sei es durch EU-Programme wie „Everything but arms“ – Besitzrechte an angestammtem Boden oder zunehmend auch Saatgut und vielem anderen durch Eigentumsrechte von Investoren gebrochen werden.
von Florian Hurtig und Friederike Habermann
Friederike Habermann ist Ökonomin, Historikerin und Autorin; zuletzt erschienen: Overcoming Exploitation and Externalisation (Routledge 2024). Florian Hurtig ist Agroforstdesigner, solidarischer Obstbauer und Autor; zuletzt erschienen: 500 Jahre Bauernkriege (Mandelbaum 2025).