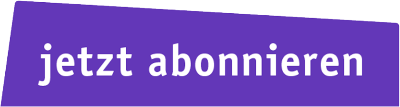Artikel von Franziska Weiland und Andreas Rosen
Seit den Landtagswahlen im September 2024 stehen viele entwicklungspolitisch Aktive in Ostdeutschland vor einer ernüchternden Realität: Die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen haben sich noch einmal spürbar verschärft. Während rechtsextremistische Positionen weiter an Einfluss gewinnen, verlieren entwicklungspolitische Perspektiven an Rückhalt. Die Bundestagswahl hat diese negativen Entwicklungen nun beschleunigt. Dies hat Folgen: für Projekte, Förderungen, Vereine und Menschen, die sich für globale Gerechtigkeit einsetzen.
Die Zivilgesellschaft im Osten Deutschlands arbeitet unter erschwerten Bedingungen: Weniger Zustimmung zu Entwicklungszusammenarbeit in der Bevölkerung, geringere Durchschnittsspenden, weniger Fördermittel auf Landesebene, geringere NRO-Dichte, mehr rechtsextreme und rassistische Übergriffe und Straftaten sowie mehr autoritäre Haltungen – auch und gerade bei jungen Menschen. Das ist keine neue Erkenntnis. Aber eine, die sich laut der aktuellen Leipziger Autoritarismusstudie dramatisch zuspitzt.
Die Wahlergebnisse in Ostdeutschland zeigen nicht nur, dass jede dritte Person eine rechtsextremistische Partei gewählt hat. Sie führen auch zu einer Zunahme politisch motivierter Straftaten und dem Anstieg von politisch motivierter Kriminalität. Zum Beispiel in Regionen wie dem Landkreis Sonneberg, wo 2023 erstmals ein AfD-Landrat gewählt wurde. Dort haben sich rechtsextreme Straftaten seither verfünffacht. Eine Zunahme rechtsextremer Gewalt ließ sich auch für Görlitz nach den Landtagswahlen von 2024 beobachten. Unmittelbar nach den Erfolgen der AfD bei den Bundestagswahlen gab es in Städten wie Senftenberg und Stahnsdorf rechtsextreme Übergriffe auf eine Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete und auf einen Jugendclub.

Auswirkungen auf entwicklungspolitische Arbeit
Im Rahmen einer Spontanabfrage der Stiftung Nord-Süd-Brücken bei einigen ostdeutschen Antragsteller*innen, ob sich ihre Situation nach den Wahlen verändert habe, berichteten Vereine von verstärkter Einschüchterung, mehr rechtsextremen Schmierereien sowie Übergriffen. Zwei Vereine verwiesen auf menschen- und demokratiefeindliche Beispiele bei ihrer entwicklungspolitischen Bildungsarbeit an Schulen.
Auch wurden mehrere Beispiele genannt, wie die extreme Rechtsverschiebung auf kommunaler Ebene entwicklungspolitische Anliegen und Kulturangebote zunehmend verhindert. So wurde im sächsischen Freiberg die Einrichtung einer Stelle für die Kommunale Entwicklungszusammenarbeit mit den Stimmen von AfD und CDU im Stadtrat verhindert, obwohl eine 90-prozentige Förderung durch die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) bereits bewilligt war. Weitere Vereine berichteten von Manövern der AfD, der Zivilgesellschaft auf kommunaler Ebene die Gelder vorzuenthalten und Vereine zu delegitimieren, unter anderem in Wurzen bei Leipzig, Mittweida/Sachsen, Sömmerda/Thüringen und Greifswald. Erschwerend kommt für die entwicklungspolitische Arbeit nach den Landtagswahlen hinzu, dass zum einen die Haushalte in Brandenburg und Sachsen noch nicht verabschiedet sind und zum anderen aufgrund der Sparpläne viele zivilgesellschaftliche Förderprogramme dramatisch gekürzt wurden. Die Folge ist, dass zivilgesellschaftliche und entwicklungspolitische Träger ihre Projekte und Programme verschieben und mit weniger Personal umsetzen müssen. Auch haben die schlechten Wahlergebnisse für die demokratischen Parteien in den drei Ländern (vor allem für Grüne, Linken und SPD) zur Folge, dass es weniger politische Fürsprache gibt. Das bereitet gerade den entwicklungspolitischen Landesnetzwerken bei deren politischer Verbandsarbeit große Sorgen.

„Shrinking Space“ in Ostdeutschland…
Viele Regionen in Ostdeutschland sind selbst ein „Shrinking Space“: Es gibt kaum andere geografische Räume in Deutschland, in denen der demografische Wandel, die Überalterung, die „demografische Maskulinisierung“, der Abbau von Daseinsvorsorge (dem auch das Vereinssterben innewohnt) und die politische Radikalisierung so eng miteinander verwoben sind.
Diese Faktoren entziehen zivilgesellschaftlichen Akteuren buchstäblich die Luft zum Atmen.
…und tapfere Initiativen
Das soll jedoch nicht heißen, dass es kein zivilgesellschaftliches Engagement gibt: So hat gerade die Zeit vor den Wahlen gezeigt, wie mutig und aktiv Teile der Zivilgesellschaft sind und wie es gelingen kann, sich kommunal oder bundeslandübergreifend zu vernetzen und der gesellschaftspolitischen Situation zu trotzen! #nordhausenzusammen, Weltoffenes Thüringen oder #unteilbarMV sind nur drei Beispiele. Was wir von diesen Initiativen und der ostdeutschen Zivilgesellschaft lernen können: Es braucht den direkten Kontakt auch mit Skeptiker*innen und Gegner*innen unserer globalen Werte und Themen. Es braucht die Bereitschaft, miteinander zu ringen, sich blutige Nasen zu holen, Grenzen zu überschreiten und Komfortzonen zu verlassen. Es sind Vereine wie die Freiberger Agenda 21, goals connect aus dem Saale-Orla-Kreis oder der ASB Sömmerda, die versuchen, mit den Menschen über entwicklungspolitische Themen ins Gespräch zu kommen und Schnittmengen auszubauen.
Was sollten wir jetzt tun?
In der zivilgesellschaftlichen Debatte plädieren wir für einen Perspektivwechsel: Ostdeutschland darf nicht länger als bloße Peripherie betrachtet werden. Vielmehr, wie der Soziologe Steffen Mau zurecht sagt, könnte Ostdeutschland in mancherlei Hinsicht ein Labor für neue demokratische Beteiligungsformen werden. Mit Blick auf Entwicklungspolitik und Globales Lernen bedeutet dies, dass entwicklungspolitische Themen nur dann gesellschaftlich relevant und erfolgreich werden, wenn sie Antworten auf die drängenden sozialen Fragen, auf die tatsächlichen und gefühlten Verunsicherungen, auf die Transformationsmüdigkeit vieler Menschen vor Ort in Kommunen, Stadtteilen und ländlichen Räumen finden.
Voraussetzung dafür ist allerdings die Bereitschaft, dass wir uns und unsere Botschaften sowie die oftmals sperrige und ausgrenzende Art der Sprache hinterfragen: Werden wir in der entwicklungspolitischen Kommunikation überhaupt verstanden – sprachlich und inhaltlich? Welchen Mehrwert hat Entwicklungspolitik für eine auf Hilfe angewiesene Seniorin aus Bitterfeld? Oder für eine junge Familie aus dem Brandenburgischen? Oder für einen Bürgermeister in Stendal? Wie verknüpfen wir Themen von globaler Gerechtigkeit mit denen von sozialer Gerechtigkeit, um uns Gehör und Relevanz zu verschaffen?
Wir brauchen zudem einen Strategie-Wechsel: Weg davon, uns an der AfD und ihren Provokationen abzuarbeiten, an ihrem Narrativ der Angst und ihrer rassistischen Migrationspolitik. Ein Beitrag entwicklungspolitischer Vereine könnte es sein, positiv besetzte Geschichten der Migration zu kommunizieren: Dass Migration natürlich ist, dass sie Teil deutscher, europäischer und weltweiter Geschichte ist, dass sie die Antwort auf viele Probleme dieser Gesellschaft – vor allem auch im Osten – sein kann, dass eine offene Gesellschaft und Asyl Kennzeichen einer lebenswerten Gesellschaft sind.

Resilienz und Solidarität
Bei verschiedenen Treffen zivilgesellschaftlicher Akteure und Initiativen in Ostdeutschland wurde zuletzt betont, dass die eigenen Strukturen resilienter werden müssen. Ähnlich wie beim Kampf gegen den Klimawandel geht es auch beim Kampf gegen den gesellschaftlichen und politischen Wandel darum, sich den härter werdenden Bedingungen besser anzupassen. Organisationen müssen robuster werden.
Dafür ist Solidarität aus dem Westen und großen Städten notwendig. Menschen und Organisationen mit Privilegien, die unter relativ guten Bedingungen arbeiten, müssen sich überlegen: Wie kann unser solidarischer Beitrag mit Engagierten in Regionen und an Orten aussehen, die stärker unter Druck stehen?
Zur größeren Resilienz kann auch der Austausch mit Aktiven aus anderen Bundesländern und international beitragen, wo die extreme Rechte schon deutlich weiter ausgeprägt ist oder war (z.B. Österreich, Niederlande, Italien, Frankreich, Polen, Ungarn, USA), um von ihnen zu lernen, wie mit den extremen Entwicklungen umgegangen werden kann, welche Strategien und Erfolge gegebenenfalls erfolgreich und übertragbar sind.
Solidarität, Resilienz und strategisches Handeln – das ist jetzt unser Auftrag, um entwicklungspolitische Initiativen und Akteure in Ostdeutschland zu unterstützen.
Wer hier wirksam ist, stärkt nicht nur regionale Strukturen, sondern entwickelt Antworten auf Herausforderungen, die bundesweit an Bedeutung gewinnen. Gerade unter Druck entsteht Innovation. Das Engagement in Ostdeutschland kann zur Blaupause für die gesamte entwicklungspolitische Inlandsarbeit in Deutschland werden.
Franziska Weiland ist Co-Geschäftsführerin des Eine Welt Netzwerk Thüringen. Andreas Rosen ist politischer Geschäftsführer der Stiftung Nord-Süd-Brücken.