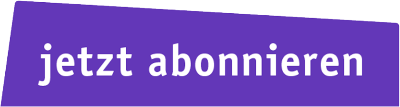Ein Artikel von Lya Cuéllar
Der Rückzug internationaler Unterstützung wie diejenige von USAID und das Erstarken autoritärer Regierungen setzen die Zivilgesellschaft in Zentralamerika unter Druck. Gleichzeitig zeigt sie große Widerstandskraft und unermüdliches Engagement. Der Globalen Norden steht vor der Aufgabe, neue Solidaritätsformen zu entwickeln und kreative Wege zu finden, die Menschenrechtsarbeit in der Region wirksam zu stärken.

Ende Januar 2025 fanden sich Hunderte von zivilgesellschaftlichen Organisationen in Zentralamerika über Nacht in einer dramatischen Situation. Die US-Regierung kündigte eine Aussetzung der Finanzierung von NGOs und Medien durch die United States Agency for International Development (USAID) für 90 Tage an. Trotz der Bemühungen einzelner Mitarbeiter*innen innerhalb der Institution, so viele Projekte wie möglich zu retten, werden weniger als 15 Prozent der Programme zum Gesundheitswesen, der Notfallhilfe und der Menschenrechte im globalen Süden den Kahlschlag überstehen (1).
Die Kürzungen schlugen wie eine Schockwelle ein und trafen nicht nur Organisationen, deren Projekte auf US-amerikanische Kooperationsmittel angewiesen waren, sondern führten auch dazu, dass weitere Geldgeber ihre Budgets anpassen mussten. Der Schlag war dabei nicht völlig unerwartet. Einerseits, weil Trump bereits während seiner ersten Amtszeit die Gelder zur Entwicklungszusammenarbeit in Zentralamerika als Verhandlungsmasse gegen die Migrantenkarawanen anwendete. Aber auch, weil die Entscheidung ein radikaler Ausdruck eines allgemeinen Trends im globalen Norden ist.
Internationale Partnerschaften im Umbruch
Viele Länder streben eine Transformation des bisherigen Modells der internationalen Zusammenarbeit an. So kürzte Deutschland in diesem Jahr das Budget des Entwicklungsministeriums um knapp eine Milliarde Euro. Auch betreibt Deutschland seit diesem Jahr keine bilaterale Entwicklungszusammenarbeit mehr mit einzelnen Staaten in Zentralamerika. Der Wechsel zur regionalen Zusammenarbeit über das System für Interamerikanische Integration (SICA) schränkt jedoch die Handlungsfähigkeit Deutschlands als demokratiefördernder Akteur vor Ort ein.
Neue Akteure wie China erweitern gleichzeitig ihre Präsenz. Diese bieten ein anderes Kooperationsmodell, das sich von der Unterstützung von Nichtregierungsorganisationen abwendet und sich auf große Infrastrukturprojekte in Partnerschaft mit Regierungen konzentriert. Die Investitionen werden nicht mit Menschenrechtsrichtlinien verknüpft. Als Gegenprojekt strebt die EU die 2022 angekündigte Global Gateway Initiative an, mit infrastrukturellen Investitionen in den Bereichen Energie, Transport, Digitalisierung, Gesundheit, Bildung und Forschung. Auch diese Strategie verfügt nicht über Instrumente, um die Einhaltung von rechtsstaatlichen und demokratischen Standards in den Partnerländern zu gewährleisten. Die zunehmend autoritären Regierungen in Zentralamerika können sich also erlauben, sich von alten einschränkenden Partnerschaften wegzubewegen.
Zivilgesellschaftlicher Widerstand in einer Region in Aufruhr
Die zivilgesellschaftlichen Akteure stehen nun mit knapperen Ressourcen vor immer größeren Herausforderungen. In zunehmend autoritären Ländern wie Nicaragua und El Salvador führt die Schließung zivilgesellschaftlicher Räume durch bürokratische Hürden und die de facto Kriminalisierung der Arbeit von Nichtregierungsorganisationen zu ihrer Schließung und zum Massenexil von NRO-Mitarbeitenden, Medienschaffenden und weiteren Menschenrechtsverteidiger*innen.
In Nicaragua nahm die Kontrolle der sandinistischen Regierung über alle Staatsgewalten und die Unterdrückung kritischer Stimmen über Jahre hinweg zu. Der Gnadenstoß kam mit der Verfassungsreform vom Januar 2025: Diese bestätigte nicht nur die absolute Macht des Präsidentenpaars Daniel Ortega und Rosario Murillo, sondern bereitete auch dessen dynastische Nachfolge nach seinem Ableben vor. In diesem Kontext und dank eines Gesetzes zur Regulierung von sogenannten „ausländischen Agenten“ wurden seit 2020 über 5.000 Organisationen geschlossen.
In El Salvador ist Präsident Nayib Bukele in die Fußstapfen von Ortega und Murillo getreten. Durch einen relativen Erfolg seiner repressiven und rechtswidrigen Sicherheitspolitik verfügt er weiterhin über starke Zustimmung unter der Bevölkerung. Bukeles Popularität hielt viele demokratische Akteure der internationalen Gemeinschaft bei Kritik zurück, als der Präsident die demokratischen Institutionen El Salvadors demontierte. Dies ermöglichte ihm unter anderem die Verabschiedung eines „Agentengesetzes“, wodurch NRO und unabhängige Medien sich in einem Register anmelden müssen, um eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Auf internationale Kooperationsgelder fällt nun eine Steuer von 30 Prozent an.
Die Entwicklung in Honduras und Guatemala hingegen weckte Hoffnung für eine progressive und demokratische Politik in Mittelamerika, die gemeinsam mit der Zivilgesellschaft die systemischen Probleme der Region angehen sollte. Der Sieg der honduranischen Linken nach zwölf Jahren Narcodiktatur brachte eine Regierung hervor, die einen Einsatz für Menschenrechtskämpfe versprach.

Gegen Ende der Präsidentschaft von Xiomara Castro und inmitten einer Krise des Wahlsystems gelang es ihrer Regierung jedoch nicht, den Schutz von Menschenrechtsverteidiger*innen vor der mörderischen Gewalt des organisierten Verbrechens – meist im Dienst von Großunternehmern – zu gewährleisten. Im Jahr 2023 inspirierte dann Guatemala die gesamte Region: In einer überraschenden Wahl und mit großer Unterstützung der Zivilgesellschaft gelang es dem Demokraten Bernardo Arévalo, an die Macht zu kommen. Es war insbesondere der Widerstand der indigenen Bevölkerung, der das Wahlsystem vor einem Putschversuch durch das von antidemokratischen Kräften kooptierte Justizsystem verteidigte. Diese sogenannte dictadura judicial (justizielle Diktatur) führt jedoch weiterhin Angriffe gegen die engagierte Zivilgesellschaft.
Bollwerk gegen den globalen Autoritarismus
Die Entwicklungen sollten im globalen Norden, in dem rechtsextremistische Parteien ebenfalls stärker werden, mit Sorge beobachtet werden. Zentralamerika ist klein, aber nicht isoliert: Antidemokratische Akteure auf der ganzen Welt blicken auf die Region, um die Strategien ihrer Regierungen zu kopieren. Andere, wie Donald Trump, verbünden sich mit zentralamerikanischen Präsidenten, um das Menschenrecht auf Asyl einzuschränken und Menschen in Fluchtsituation zu bestrafen.
Fälle wie Guatemala zeigen jedoch, dass auch in scheinbar hoffnungslosen Kontexten eine starke und organisierte Zivilgesellschaft dem Autoritarismus entgegenwirken kann. Die antidemokratischen Akteure wissen das auch: Deshalb versuchen korrupte politische Eliten, organisiertes Verbrechen und extraktivistische Unternehmen, solche kritischen Stimmen zum Schweigen zu bringen.
Die internationale Unterstützung für die Verteidiger*innen der Demokratie in Zentralamerika ist daher wichtiger denn je. Deren Arbeit dient nicht nur als Bollwerk gegen Autoritarismus, sondern als mögliches Vorbild für den Widerstand gegen antidemokratische Akteure auf der ganzen Welt.
Dafür muss die europäische Zivilgesellschaft weiterhin Druck auf ihre Regierungen ausüben, um den Kurs gegen Kooperation umzukehren. Gleichzeitig müssen wir anerkennen, dass die Entwicklungszusammenarbeit eine Transformation durchlaufen wird. Die große Herausforderung für die internationale und zentralamerikanische Zivilgesellschaft in dieser neuen Phase besteht also darin, kreativ neue Wege zu finden, um die Solidarität zwischen dem globalen Süden und Norden in die Praxis umzusetzen.
(1) New York Times: What Remains of U.S.A.I.D. After DOGE’s Budget Cuts?
Lya Cuéllar ist Politologin und Journalistin aus El Salvador. Sie koordiniert den Runden Tisch Zentralamerika (RTZA) und lebt in Berlin.
Neugierig geworden? Das FoodFirst-Magazin können Sie hier abonnieren. Oder sichern sie sich ein kostenloses Probeexemplar in gedruckter Form. Schreiben Sie einfach eine Mail an info@fian.de.