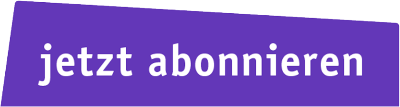GUATEMALA- Nur Wasser für Palmenplantagen
„Wir wollen kein verschmutztes Wasser trinken oder unsere Bohnen damit kochen. Doch sauberes Wasser müssen wir kaufen.“ So begrüßt mich Juana Choc im kleinen Dorf Esperancita del Río im Norden Guatemalas. Die Landschaft wirkt auf den ersten Blick grün und üppig – doch dieser Eindruck trügt. Wo früher Flüsse geflossen sind und Wälder Schatten gespendet haben, stehen heute endlose Reihen von Ölpalmen. Ihre Früchte werden zu Palmöl verarbeitet und nach Europa exportiert – auch nach Deutschland.
Seitdem das Unternehmen Chiquibul hier eine große Plantage betreibt, führt der nahegelegene Fluss Río San Román, einst Lebensader der Gemeinde, kaum noch Wasser. „Die Ölpalmen verbrauchen viel Wasser. Außerdem wird der Fluss mit Chemikalien und Abfällen verschmutzt“, erklärt mir Santiago Caal, die Indigene Autorität der Gemeinde.
Die Auswirkungen des verschmutzen Wassers sind katastrophal: Es gibt kaum Wasser zum Trinken und Kochen oder zur Bewässerung der Felder. Das führt zu eingeschränkter Ernährungssicherheit und gesundheitlichen Probleme. Juana erzählt mir, wie sich ihr Leben dadurch verändert hat: „Früher haben wir uns aus dem Fluss und dem Wald ernährt. Jetzt gibt es keine Tiere und keine Fische mehr. Wir können nicht einmal mehr baden.“
Die Menschen sind wütend – aber nicht hilflos. Um ihren einzelnen Stimmen mehr Kraft zu verleihen, haben sie zusammen mit 20 anderen Indigenen Gemeinschaften der Region die Bewegung zur Verteidigung des Wassers Q’ana Ch’och´ gegründet. Sie setzt sich dafür ein ihre Territorien vor der Verbreitung der Monokulturen zu schützen und fordert die Einhaltung ihre Menschenrechte auf Wasser, Nahrung und Land sowie ihre Indigenen Weltanschauungen und Spiritualität zu respektieren. Trotz ihrer Bemühungen, den Ökozid am Río San Román bei den nationalen Behörden anzuzeigen, unternimmt der Staat nichts. Zuletzt beschlossen sie, den Fall vor die Interamerikanische Menschenrechtskommission zu bringen, mit der Hoffnung Gerechtigkeit zu erlangen.

Allein in den letzten zehn Jahren hat sich die Anbaufläche für Palmöl in Guatemala mit aktuell 180.000 Hektar fast verdoppelt. Die Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Zentralamerika hat den Palmöl-Boom begünstigt und ermöglicht, dass Guatemala zu den größten Produzenten der Welt gehört. Neben seiner Verwendung in der Energie- und Lebensmittelindustrie findet es sich auch in Tierfutter, Kosmetika, Seifen und Waschmitteln.
Während vom Export des Palmöls nur wenige Großunternehmen profitieren, führen sie in den Gebieten Indigener Gemeinschaften zu massiver Umweltverschmutzung, Landkonflikten und Vertreibungen. Ebenso sind Arbeitsrechtsverletzungen weit verbreitet.
Der Fluss als Rechtssubjekt
Am Eingang des Ortes wird man von zwei eindrücklichen Schildern begrüßt: „Unser Land steht nicht zum Verkauf“ – eine klare Botschaft an die Palmölunternehmen, die seit 15 Jahren versuchen, sich die Ländereien anzueignen. Auf dem anderen Schild steht: „El rio San Roman tiene vida“ – was so viel bedeutet wie: der Fluss lebt.
In der Maya-Queqchi Kosmovision sind die Natur und ihre Elemente nicht nur Lebensumwelt, sondern Lebewesen, mit denen man in Beziehung tritt, die man ehrt und im Gleichgewicht hält. Deshalb haben die Bewohner*innen von Esperancita del Río ihren Fluss San Román zum Rechtssubjekt erklärt, inspiriert von Indigenem Weltverständnis, wie sie auch aus Ecuador und Neuseeland bekannt sind. Eines der Ziele ist die juristische Anerkennung durch den guatemaltekischen Staat. „Für uns ist der Río San Román wie ein Lebewesen“, sagt Santiago Caal.

HONDURAS – Wenn Wasser zum Luxus wird
Meine Rundreise führte mich weiter nach Honduras, genauer an den Golf von Fonseca, nahe der Pazifikküste. Diese Region wird von der Agrarindustrie dominiert, ausgerichtet am Export. Während Honduras auch Deutschland mit Zuckerrohr, Melonen und Garnelen versorgt, bleibt dort ein ökologisches Desaster zurück.
In Cedeño, einem Dorf mit etwa 7.000 Einwohner*innen, waren vor einigen Jahren der Tourismus und die Fischerei die wichtigsten Wirtschaftszweige. Heute ist der Strand beinahe verschwunden und es sind kaum noch touristische Geschäfte zu finden – der steigende Meeresspiegel und die Agrarindustrie haben das Dorf schwer getroffen.
Sauberes Trinkwasser ist kaum noch vorhanden. Die Einwohner*innen beklagen, dass die lokalen Behörden nicht in der Lage seien, die Gemeinde mit fließendem Wasser zu versorgen, und die Zentralregierung schaut weg. Brunnen sind versalzen oder mit Fäkalien und Agrargiften kontaminiert. Viele Familien geben bis zu 80 % ihres Einkommens für abgepacktes Wasser in kleinen Plastikbeuteln aus – teuer, gesundheits- und umweltschädlich zugleich.

20 km von Cedeño entfernt liegt der Ort El Guapinol, wo ich Heráclito und Juan Pablo kennengelernt habe. Heráclito kam mit seiner Familie im Jahr 1972 aufgrund der guten Bedingungen zum Fischen hierher. Mit der Ankunft der Garnelenfarmen hat sich alles verändert. Sie zerstören mehr und mehr Flächen von Mangrovenwälder, verschmutzen die umgebenden Gewässer und reduzieren damit massiv tierischen Lebensraum und die Ernährungsgrundlage der dort ansässigen Gemeinden. Die Garnelenfarmen sind jedoch nicht die einzige Bedrohung für die Einwohner*innen von Guapinol. Die Zuckerfabrik La Grecia, eine der größten Produzenten des Landes, leitet nicht nur chemische Abfälle ins Meer, in Flüsse und ins Grundwasser, sondern versprüht auch mit Flugzeugen Pestizide über den Plantagen, die sich direkt neben der Gemeinde befinden. Juan Pablo, bringt es auf den Punkt: „Die Zuckerrohrplantagen verschmutzen alles“. Zudem hat die Agrarindustrie öffentliche Wege privatisiert und den Zugang zum Meer zum Fischen verwehrt. Den Protesten begegnen die privaten Sicherheitskräfte mit Einschüchterungen und Drohungen.
Heráclito: „Der Staat gibt ihnen die Erlaubnis, unsere Gewässer zu verschmutzen“
Als letzte Station auf meiner Reise besuchte ich Namasigüe, ein Dorf im Landesinneren, deren Bewohner*innen ihren Lebensunterhalt durch Landwirtschaft und traditioneller Aquakultur bestreiten. Cupertino, 54 Jahre alt, baut Bohnen und Mais für den Eigenbedarf und den Verkauf an. Hier kann man das Land bewirtschaften, da es weiter von der Küste entfernt liegt und daher nicht versalzen ist. Er erzielt auch zusätzliche Einnahmen aus der Garnelenzucht. Wie er jedoch zugibt, ist es nicht möglich, mit den großen Garnelenfarmen zu konkurrieren, die den Zugang zu den großen Märkten innerhalb und außerhalb des Landes haben. Viele Einwohner*innen von Namasigüe müssen unter sehr prekären Arbeitsbedingungen als Angestellte in diesen Fabriken arbeiten, um ihre Familien ernähren zu können.

Recht auf Wasser statt Exportprofite
Was ich auf dieser Reise gesehen habe, sind Menschenrechtsverletzungen, die direkt mit unserem Konsum zu tun haben. Palmöl, Zucker, Garnelen – sie landen in europäischen Supermärkten, während die Menschen in den Herkunftsländern ihr Wasser verlieren. Die EU-Zentralamerika Handelsbeziehungen erweiterten mit dem Inkrafttreten der kommerziellen Säule des Assoziierungsabkommen vor über 10 Jahren. Das, hat die Ausbeutung auf Kosten der Menschenrechte und der Umwelt beschleunigt. Exporte steigen – Menschenrechte bleiben auf der Strecke. Der Bestand wichtiger Gesetze, die zum Schutz der betroffenen Gemeinden und der Natur beitragen könnten, wie das deutsche und das EU-Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz oder die EU-Verordnung für entwaldungsfreien Lieferketten, ist fraglich.
Wir von FIAN sagen: Wir brauchen starke verbindliche Vorschriften, die die Menschenrechte und die Umwelt vor kommerziellen Interessen schützen. Schluss mit Handelsabkommen, die Wasserraub und Umweltzerstörung fördern!
Auch Sie können dazu beitragen das Recht auf sauberes Wasser in Lateinamerika zu stärken. Spenden Sie an FIAN, damit wir weiterhin Druck auf die Verantwortlichen ausüben können.
So stärken Sie das Recht auf Nahrung weiter:
- Mit Ihrer Spende
- Aktiv werden bei FIAN
- Mit einer Mitgliedschaft bei FIAN