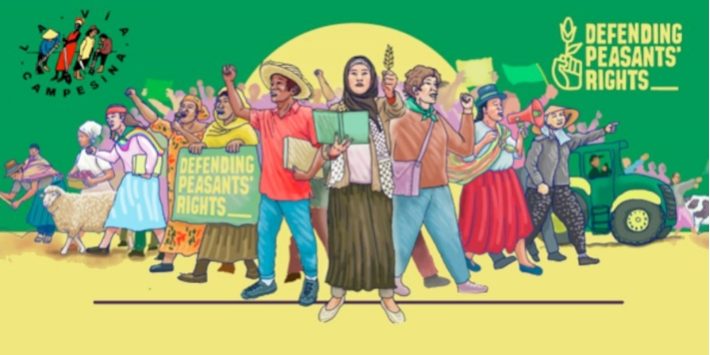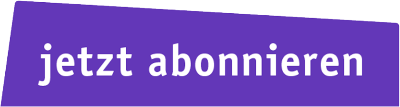Die Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen, welche die Umsetzung der UN-Kleinbäuer*innenerklärung (UNDROP) überprüft, befasst sich in ihrem kürzlich veröffentlichten Bericht mit aktuellen weltweiten Entwicklungen und strukturellen Gefährdungen für die Rechte von Bäuer*innen und anderen auf dem Land arbeitenden Menschen. FIAN hat den jahrelangen Prozess zur Verabschiedung der Erklärung begleitet und unterstützt. Zur Erstellung des neuen Berichts konnte FIAN u.a. durch die Moderation einer Betroffenenkonsultation der Arbeitsgruppe beitragen. Wir haben den umfassenden Bericht ausschnitthaft zusammengefasst.

Gegenstand des Berichts sind der bäuerliche Zugang zu Land- und Wasser, geschlechtsspezifische Fragen im Zusammenhang mit dem Klimawandel, soziale Schutzmaßnahmen, die Ausbeutung von Arbeitskräften und unfaire Handelssysteme. Die Arbeitsgruppe hebt einige positive Maßnahmen hervor, die von Staaten ergriffen wurden, um diese Probleme anzugehen und die Situation der Rechteinhabenden zu verbessern. Abschließend fordert sie Staaten, internationale Gremien und die Zivilgesellschaft dazu auf, ihren menschenrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen, die aufgezeigten Verstöße zu ahnden und die Erklärung in Verfassungen, Gesetzen und Praktiken zu verankern.
Terriotorialrechte und Gesetze zur Förderung des bäuerlichen Lebens: Territoriale Rechte sind zentral für die Lebensgrundlagen, Kultur und soziale Struktur bäuerlicher Gemeinschaften. Ihre weltweite Verletzung – etwa durch „Land Grabbing“ (Landraub), unsichere Besitzverhältnisse, Investoreninteressen und neoliberale Reformen – führt zu einer komplexen Kette von Ungerechtigkeiten, die das Überleben und die Würde von Bäuer*innen bedroht. Land wird zunehmend als Finanzanlage behandelt, somit liegt immer mehr Land und dessen Kontrolle in Händen weniger Personen, was zu einer ungleichen Verteilung von Land und Gewinnen führt. Weltweit bewirtschaften nur 1 % der landwirtschaftlichen Betriebe 70 % der Ackerflächen.
Der Bericht nimmt eine Eingabe von FIAN Indonesien auf, derzufolge sich Landkonflikte unter der derzeitigen Regierung fast verdoppelt haben, was vor allem auf Infrastrukturprojekte zurückzuführen ist. Zwischen 2015 und 2023 wurden 2.939 Landkonflikte identifiziert. Der Plantagensektor war für fast 40 Prozent aller seit 2015 registrierten Konflikte verantwortlich, wobei insbesondere der Anbau von Ölpalmen mit massiver Entwaldung und Landraub in Verbindung gebracht werden. Das Merauke-Food-Estate-Projekt ist ein Beispiel für systematische Verletzungen der Landrechte indigener Völker: 3 Millionen Hektar Land in Merauke, eine Fläche, die 45 Mal so groß ist wie Jakarta, sollen gerodet werden. Zwei Drittel davon sollen für Zuckerrohrplantagen und der Rest für Reisfelder genutzt werden, während indigene Papua berichten, dass sie nie ordnungsgemäß informiert oder konsultiert wurden.
Trotz dieser Herausforderungen werden auch positive Entwicklungen hervorgehoben. In Kolumbien erkennt ein Gesetz aus dem Jahr 2023 die Bäuer*innennschaft als Gegenstand besonderer verfassungsrechtlicher Schutzmaßnahmen an und bestätigt die historische Diskriminierung sowie die Notwendigkeit der Einrichtung eines Sondergerichts für diesen Sektor. Gemäß einem Gesetz aus dem Jahr 2020 müssen öffentliche Lebensmittelversorgungsprogramme mindestens 30 Prozent ihres Budgets für den Kauf lokaler Produkte aus familiärer, bäuerlicher und gemeinschaftlicher Landwirtschaft aufwenden. Mit einem Beschluss aus dem Jahr 2024 führte das Landwirtschaftsministerium das Konzept der Agrarökologie ein, während es mit einem weiteren Beschluss aus dem Jahr 2017 Leitlinien für die Familien-, Kleinbäuer*innen- und Gemeinschaftslandwirtschaft verabschiedete, die von Bäuer*innennorganisationen für nationale und regionale Interessenvertretung genutzt werden. Darüber hinaus ist das Nationale System für Agrarreform und ländliche Entwicklung ein Mechanismus zur Planung und Koordinierung der Agrarreform mit dem Ziel, die Lebensqualität zu verbessern und territoriale Rechte zu gewährleisten.
Fluss- und Seerechte: Fischergemeinschaften verlieren zunehmend ihre traditionellen Rechte auf Flüsse, Küsten und Meere durch staatliche und private Übernahmen („Ocean-Grabbing“). Dies untergräbt ihre kulturelle Identität und verletzt die Rechte auf Land, natürliche Ressourcen, Ernährungssouveränität und eine saubere Umwelt. In den Philippinen drohen Küstengemeinden Vertreibungen durch den Ausbau von Tourismus- und Großprojekten.
Gewalt, Kriminalisierung und Unterdrückung: Wenn Bäuer*innen ihre Rechte verteidigen, sind sie häufig Gewalt, Kriminalisierung und Unterdrückung ausgesetzt. Das kann Zwangsräumungen, willkürliche Inhaftierungen und juristische Schikanen bedeuten. Regierungen und verbündete Medien stigmatisieren Bauernorganisationen oft als „Feinde des Staates“. So werden beispielsweise auf den Philippinen Bäuer*innen und Aktivist*nnen durch das sogenannte „Red Tagging“ als Terroristen gebrandmarkt, oft ohne Beweise, um diese einzuschüchtern und mundtot zu machen. Trotz dieser Herausforderungen gab es auch positive Entwicklungen: so hat Kolumbien beispielsweise 2023 ein Agrargericht eingerichtet, die speziell für die schnelle und einfache Lösung agrartypischer Konflikte zuständig sind.
Geschlechterdiskriminierung: Obwohl die UN-Erklärung Geschlechter-Gleichberechtigung garantiert, sieht die Realität oft anders aus. Tiefe patriarchale Strukturen, wirtschaftliche Benachteiligung und diskriminierende gesetzliche sowie traditionelle Regelungen bedingen, dass Frauen eingeschränkten Zugang zu Land und das Recht auf Erbschaft haben. Obwohl beispielsweise Bäuer*innen in Kenia 80 Prozent der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte ausmachen, besitzen sie nur 5 Prozent des Landes. Trotz dieser Herausforderungen gibt es auch positive Entwicklungen, zum Beispiel in Uganda: Dort unterstützt die Organisation Katosi Women Development Trust (eine Partner*organisation von FIAN Uganda) Frauen dabei, Landtitel zu erhalten.
Klimawandel: Gleichzeitig bedroht der Klimawandel systematisch die Existenzgrundlagen der Bäuer*innen, die am wenigsten zu den globalen Emissionen beigetragen haben. Laut der FAO könnte der Klimawandel bis 2030 rund 122 Millionen Menschen zusätzlich in extreme Armut treiben, vor allem Kleinbäuer*innen. Die UN-Erklärung verpflichtet Staaten, Umwelt und landwirtschaftliche Produktionsgrundlagen zu schützen. Die unzureichende Bekämpfung des Klimawandels stellt somit eine direkte Verletzung dieser Pflicht dar, da Umweltschäden die Lebensgrundlage vieler Bäuer*innen zerstören. Die Auswirkungen sind vielfältig: Ernteausfälle durch Dürren, Überschwemmungen oder Hitzewellen gefährden die Ernährungssicherheit und verletzen das Recht auf Nahrung.
Ernährungssouveränität und nachhaltige Lebensgrundlagen: Die UN-Erklärung garantiert das Recht auf Ernährungssouveränität, ein angemessenes Leben, gerechtes Einkommen und Marktzugang. In der Praxis werden diese Rechte jedoch oft durch globale Marktstrukturen untergraben. Weltweit drücken große Agrarkonzerne durch Preisvorgaben und effizienzgetriebene Lieferketten die Einkommen von Kleinbäuer*innen. In Indien und Frankreich sind viele Insolvenzen und sogar Suizide von Bäuer*innen auf Schulden und zu niedrige Preise zurückzuführen. Es gibt jedoch auch positive Ansätze: In Tansania konnten Kleinbäuer*innen im Rahmen des „First Mile“-Projekts über SMS Echtzeit-Preisinformationen erhalten und sich so gegen die Ausbeutung durch Mittelsmänner durchsetzen.
Arbeitsrechte und soziale Sicherheit: Landarbeiter*innen sind häufig schweren Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt. Dazu zählen ausbeuterische Löhne, gefährliche Arbeitsbedingungen und der Ausschluss aus sozialen Sicherungssystemen. Viele sind informell oder saisonal beschäftigt, oft ohne Arbeitsverträge – das macht sie anfällig für Lohnbetrug, Kinderarbeit und die ungeschützte Arbeit mit giftigen Pestiziden. Frauen und Migrant*innen sind besonders betroffen. Trotz Herausforderungen gibt es auch positive Entwicklungen: Das indische Gesetz zur nationalen Beschäftigungsgarantie in ländlichen Gebieten (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) garantiert ländlichen Haushalten mindestens 100 Tage bezahlte Beschäftigung pro Jahr.
Recht auf Saatgut: Traditionelles Saatgut ist für Bäuer*innen essenziell für die Erhaltung der Biodiversität und die Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel. Internationale Abkommen, Patente und nationale Saatgutgesetze fördern die Privatisierung und Vereinheitlichung von Saatgut. Dies schränkt die Rechte der Bäuer*innen ein, ihr eigenes Saatgut zu nutzen, zu tauschen oder zu verkaufen. In einigen Ländern, wie beispielsweise Kenia, drohen sogar Geldstrafen oder Gefängnisstrafen für die Verwendung nicht zertifizierten, traditionellen Saatguts. Ein positives Gegenbeispiel ist Brasilien: Dort unterstützt das staatliche „Food Acquisition Programme“ gezielt die Verbreitung traditioneller und agrarökologischer Saaten.
Herausforderungen für rechtliche, institutionelle und außergerichtliche Rahmenbedingungen: Es werden zugängliche Rechtssysteme zum Schutz der Rechte von Bäuer*innen gefordert. Dennoch gibt es weltweit systemische Mängel in rechtlichen Rahmenbedingungen und Justizinstitutionen, die diese Rechte untergraben. Viele Länder haben zwar Gesetze, die bäuerliche Rechte fördern könnten, aber deren Umsetzung und Durchsetzung sind oft schwach.
Zu den wichtigsten Empfehlungen für Staaten gehören:
- Die Erklärung formell anerkennen und in nationale Verfassungen, Rechtsrahmen und Entwicklungspolitiken integrieren, um sicherzustellen, dass ihre Grundsätze rechtsverbindlich und durch wirksame gerichtliche und außergerichtliche Beschwerdemechanismen für die ländliche Bevölkerung durchsetzbar sind.
- Die territorialen Rechte aller Rechteinhabenden gemäß der Erklärung anzuerkennen und zu schützen, indem ihre kollektive Verwaltung aller für ihr Leben und ihren Lebensunterhalt wichtigen Ökosysteme, einschließlich landwirtschaftlicher Flächen, Küsten- und Meeresgebiete, Wälder, Feuchtgebiete, Flüsse, Weiden und angestammte Gebiete, gesetzlich garantiert wird.
- Aufhebung oder Änderung von Anti-Terror- und Ordnungsgesetzen, die dazu dienen, Proteste, das Sammeln von Saatgut oder die Landnutzung durch Bäuer*innen unter Strafe zu stellen, und Verbot der Nutzung strategischer Rechtsstreitigkeiten gegen die Beteiligung der Öffentlichkeit und anderer Formen der Rechtsstreitigkeiten.
- Neuausrichtung der Agrarpolitik zur Unterstützung der Ernährungssouveränität und der bäuerlichen Agrarökologie, wobei die Produktion für lokale und nationale Märkte Vorrang vor exportorientierter Monokultur haben sollte.
- Alle diskriminierenden Gesetze aufheben und Gewohnheitspraktiken beenden, die Frauen daran hindern, Land zu besitzen, zu erben und zu kontrollieren, und gezielte Programme, einschließlich gemeinsamer Eigentumsrechte, umsetzen, um die Landrechte für Frauen in ländlichen Gebieten zu sichern.
- Die Beteiligung von Bäuer*innennorganisationen an internationalen Foren wie den Vereinten Nationen sicherstellen, insbesondere an denen zu Klimawandel, Biodiversität und Agrarökologie.
- Die Förderung von Maßnahmen einzustellen, die die Privatisierung von Land, Deregulierung und Handelsliberalisierung auf Kosten der Lebensgrundlagen der Bäuer*innen und deren Ernährungssouveränität vorschreiben.
- Weiterer Aufbau von Kapazitäten an der Basis und internationaler Solidarität, um für die Umsetzung der Erklärung auf lokaler, nationaler und globaler Ebene einzutreten.
- Durchführung partizipativer Forschungsarbeiten mit bäuerlichen Gemeinschaften, um die Ursachen von Rechtsverletzungen zu analysieren und die Auswirkungen der Umsetzung der Erklärung zu bewerten, einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Agrar- und Ernährungspolitik.
Den vollständigen Bericht finden Sie hier.